
Bilder



28. Juni 2014
Jede Katze ist liberaler als die Grünen

24. Mai 2014
Letzte Ratgeber zur Europawahl
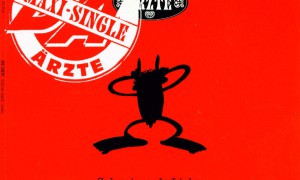
4. März 2014
Man kuschelt nicht mit Despoten

6. Februar 2014
