
Autor: Lasse




12. Mai 2018
Twitter-Troll-Treffen im Real-Life

10. Mai 2017
Der Tag, an dem wir den Euro nach Jermuk brachten
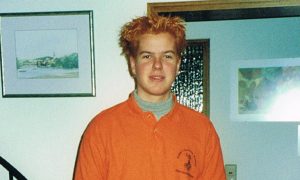

17. September 2016
TTIP-Großdemo schränkt Meinungsfreiheit ein
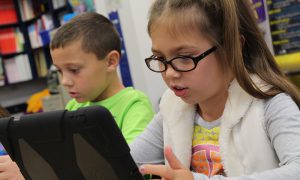
30. Juli 2016
Schulen aus der Kreidezeit holen


5. Juni 2016
