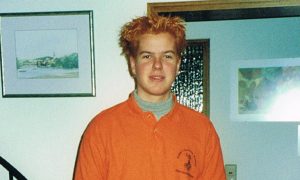
Kategorie: Hessen
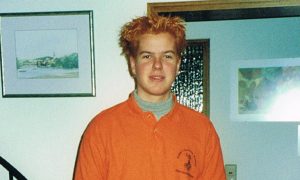
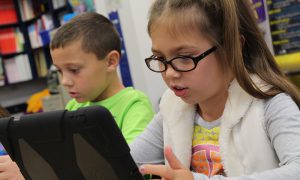
30. Juli 2016
Schulen aus der Kreidezeit holen

5. Juni 2016
Was Neoliberalismus ursprünglich bedeutet.

24. August 2015
Offener Brief: Danke für fast 14 sehr spannende Jahre
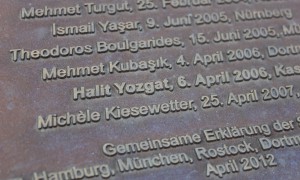
6. April 2015
Das hessische Opfer der NSU-Morde heißt Halit Yozgat.
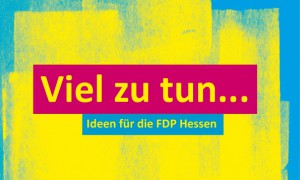
22. März 2015
Noch viel zu tun …

17. September 2014
Interview „Schwarz-Grün regiert bislang nicht“

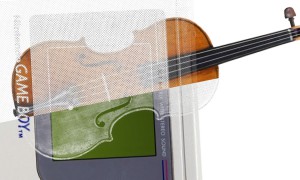
24. August 2014
Kevin, Chantal, Sophia und Maximilian*

28. Juni 2014
